Kompetenzen für nachhaltiges Lernen: Der Schlüssel zur zukunftsfähigen Personalentwicklung
„Wir müssen weg von Folien, hin zu mehr medialem Content!“, appellierte Professor Meinel in unserem Online-Webcast „Digitale Lernkultur: Der Weg zur zukunftsfähigen Verwaltung“ am 18.02.2025 – und sorgte damit bei Ulrike Hagemann, Expertin für nachhaltige Kompetenzentwicklung, prompt für ein herzliches Schmunzeln.
Denn ironischerweise hatten beide Vortragenden ihre Vorträge klassisch mit Folien vorbereitet – und eben nicht mit digitalen Lern-Nuggets oder Videos. Ein humorvoller Moment, der auf charmante Weise die aktuelle Herausforderung in der Bildungs- und Arbeitswelt verdeutlicht: Das traditionelle Lernen mit endlosen PowerPoint-Präsentationen ist längst nicht mehr zeitgemäß.
Doch worum genau geht es bei diesem notwendigen Wandel? Ulrike Hagemann, die seit vielen Jahren Unternehmen und Verwaltungen bei der Entwicklung moderner Lernkonzepte begleitet, stellte in ihrem Vortrag zentrale Fragen in den Mittelpunkt: Warum müssen wir unsere Lernkultur grundlegend überdenken? Welche Rolle spielen dabei Werte und Kompetenzen, um Mitarbeitende auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten – Herausforderungen, die wir heute oft noch gar nicht genau kennen?
Genau darum soll es in diesem Blogbeitrag gehen. Ziel ist es, praxisnah aufzuzeigen, warum es höchste Zeit für eine kompetenzorientierte, nachhaltige und flexible Lernkultur ist – und wie Unternehmen und öffentliche Einrichtungen diesen Wandel konkret gestalten können, um Mitarbeitende gezielt und nachhaltig zu fördern.
Lernkultur im Wandel – Warum bisherige Methoden nicht mehr ausreichen
Unsere Arbeitswelt verändert sich heute schneller denn je – neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, agiles Arbeiten und ständig wachsende Anforderungen an Mitarbeitende stellen Unternehmen und Verwaltungen täglich vor große Herausforderungen. Die Geschwindigkeit, mit der Wissen veraltet und neue Fähigkeiten benötigt werden, hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen. Klassische Methoden der Wissensvermittlung, die auf lange Vorträge, unzählige Folien und frontale Präsentationen setzen, kommen an ihre Grenzen.
Traditioneller Wissenstransfer konzentriert sich oft ausschließlich auf die Vermittlung von Fakten und fachlichem Know-how („Hard Skills“). Doch das reicht in der heutigen dynamischen und komplexen Welt nicht mehr aus. Vielmehr sind Mitarbeitende gefordert, eigenständig und kreativ mit neuen Situationen und Herausforderungen umzugehen. Es geht nicht nur darum, Wissen aufzunehmen, sondern dieses flexibel und selbstorganisiert in der Praxis anzuwenden und ständig weiterzuentwickeln.
Der renommierte Bildungsexperte Werner Sauter bringt dies treffend auf den Punkt:
Menschen können nicht belehrt werden, sie sind aber lernfähig.
Sauter, 2019
Damit verdeutlicht er: Nachhaltiges Lernen braucht neue Ansätze. Anstelle des bloßen „Belehrens“ muss eine Lernkultur etabliert werden, die Selbstorganisation, Eigenverantwortlichkeit und kontinuierliche Kompetenzentwicklung gezielt fördert. Denn nur so können Unternehmen und ihre Mitarbeitenden der zunehmenden Veränderungsgeschwindigkeit dauerhaft gerecht werden.
Werte und Kompetenzen als neues Fundament für nachhaltiges Lernen
Was steckt hinter Werten, Skills und Kompetenzen?
Wer heute von Lernen spricht, meint längst mehr als das reine Aneignen von Wissen. In modernen Lernkonzepten stehen Werte und Kompetenzen im Mittelpunkt – sie bilden das Fundament einer zukunftsfähigen, nachhaltigen Lernkultur. Nach dem Kompetenzmodell von John Erpenbeck und Werner Sauter (2018) sind Kompetenzen die Fähigkeit, in offenen, unüberschaubaren, komplexen, dynamischen – und teils chaotischen – Situationen selbstorganisiert zu handeln. Es geht also um weit mehr als nur fachliches Know-how.
Werte wiederum sind der innere Kompass dieses Handelns. Sie geben Orientierung, beeinflussen unsere Entscheidungen und prägen unsere Haltung. Ohne sie bleiben Kompetenzen inhaltsleer – denn erst durch die Verbindung mit persönlichen Werten entstehen echte Handlungsfähigkeit und Selbststeuerung im Lernprozess.
Hard Skills vs. Soft Skills – mehr als nur Fachwissen
Traditionell wird in Unternehmen häufig zwischen „Hard Skills“ und „Soft Skills“ unterschieden.
- Hard Skills sind messbare, fachliche Qualifikationen: etwa IT-Kenntnisse, Sprachfertigkeiten oder Projektmanagement-Methoden.
- Soft Skills hingegen betreffen soziale, kommunikative und persönliche Fähigkeiten – also den Bereich, in dem Werte und Kompetenzen unmittelbar greifen.
Im Lernprozess zeigt sich jedoch: Die wirksamste Entwicklung entsteht im Zusammenspiel beider Bereiche. Fachwissen allein reicht nicht, wenn es an Kommunikationsfähigkeit, Entscheidungsfreude oder Verantwortungsbewusstsein mangelt. Erst wenn Hard Skills durch gelebte Soft Skills ergänzt werden, entsteht die Fähigkeit, Wissen wirksam und eigenverantwortlich in die Praxis zu übertragen.
Selbstorganisation als Schlüsselkompetenz
In einer Welt voller Unsicherheiten und schneller Veränderungen wird die Fähigkeit zur Selbstorganisation zur zentralen Kompetenz. Wer selbstständig lernen, handeln und sich weiterentwickeln kann, ist besser gewappnet für neue Aufgaben und komplexe Herausforderungen. Ulrike Hagemann betont in ihrem Vortrag, dass genau hier der Hebel für erfolgreiche Personalentwicklung liegt: Nicht mehr das „Was“ des Lernens steht im Vordergrund, sondern das „Wie“.
Kompetenzen sind dabei nichts, was man einfach „vermitteln“ kann. Sie entstehen durch Erfahrung, Reflexion und aktives Tun – im besten Fall begleitet durch ein unterstützendes Lernumfeld, das Eigenverantwortung fördert und Werteorientierung ermöglicht.
Praxischeck: Wie Unternehmen Kompetenzen gezielt entwickeln können
Wie lässt sich der Wandel von der klassischen Weiterbildung hin zu einer echten Kompetenzentwicklung konkret gestalten? Ulrike Hagemann hat in ihrem Vortrag ein praxisnahes Modell vorgestellt, das diesen Transformationsprozess Schritt für Schritt abbildet – von der ersten Standortbestimmung bis zur Umsetzung im Arbeitsalltag.
Entwicklungsgespräch: Kompetenzen sichtbar machen
Am Anfang steht ein gemeinsames Entwicklungsgespräch zwischen Mitarbeitenden, Führungskraft und ggf. Lernbegleiter*in. Ziel ist es, das individuelle Kompetenzprofil sichtbar zu machen – häufig mithilfe einfacher Selbst- oder Fremdeinschätzungen. Dabei geht es nicht nur um fachliche Fähigkeiten, sondern insbesondere um überfachliche, persönliche und soziale Kompetenzen sowie zugrunde liegende Werte. Auf dieser Basis werden individuelle Kompetenz- und Lernziele formuliert, die mit den strategischen Lernzielen des Unternehmens abgestimmt werden.
Kick-off: Lernkonzeption, Community und Verantwortung
Im nächsten Schritt erfolgt der offizielle Start: ein Kick-off, in dem die Lernkonzeption vorgestellt, Lernpatenschaften vereinbart und – wo möglich – sogenannte Communities of Practice gebildet werden. Diese fachbezogenen Lerngruppen fördern den Austausch und sorgen dafür, dass Lernen nicht isoliert geschieht. Wichtig ist: Von Anfang an steht die Eigenverantwortung der Teilnehmenden im Fokus. Sie sollen ihren Lernweg aktiv mitgestalten.
Selbstlernphase: Lernen als selbstgesteuertes Entwicklungsprojekt
Herzstück des Modells ist die Selbstlernphase, in der die Mitarbeitenden eigenverantwortlich an einem konkreten Entwicklungsprojekt arbeiten. Dieses kann beispielsweise die Einführung eines neuen Prozesses oder einer Technologie begleiten – das Gelernte fließt direkt in den Arbeitsalltag ein. Begleitet wird diese Phase durch E-Learnings, Coaching-Impulse, digitale Lernsprechstunden und Austauschformate mit der Community. Ein Projekttagebuch unterstützt dabei, Erfahrungen zu reflektieren und den Lernfortschritt zu dokumentieren.
Abschluss: Workshop zur Reflexion und Praxisumsetzung
Am Ende steht ein gemeinsamer Abschluss-Workshop. Hier werden die Ergebnisse der Selbstlernphase präsentiert, reflektiert und in Bezug zur beruflichen Praxis gesetzt. Wichtig: Auch die Umsetzung in den Alltag wird konkret geplant – inklusive verbindlicher Vereinbarungen zur Weiterarbeit. Der Lernprozess endet also nicht mit dem Workshop, sondern fließt nachhaltig in die tägliche Arbeit ein.
Praxisbeispiel: Kleine Lern-Nuggets mit großer Wirkung
Wie so ein Lernprozess im Kleinen aussehen kann, zeigt Hagemann mit einem eingängigen Vergleich: Wer heute wissen möchte, wie man einen Fahrradreifen flickt, sucht nicht in einem Lehrbuch – sondern auf YouTube. Kurze, verständliche Videos vermitteln schnell anwendbares Wissen genau dann, wenn es gebraucht wird.
Diese Logik übertragen viele Unternehmen auf ihre Weiterbildungsstrategie: In Form von kurzen Lernvideos oder sogenannten Lern-Nuggets werden relevante Inhalte schnell und praxisnah aufbereitet – oft sogar von Mitarbeitenden selbst produziert. Das steigert nicht nur die Akzeptanz, sondern auch den Transfer in den Arbeitsalltag. So wird Lernen nicht zum Sonderfall, sondern zum festen Bestandteil der täglichen Arbeit.
Digitale Begleitung und die neue Rolle der Personalentwicklung
Die Rolle der Personalentwicklung befindet sich im Umbruch. Während sie früher oft als „Verwalter“ von Weiterbildung agierte – mit standardisierten Schulungskatalogen und gelegentlichen Präsenzseminaren – wird heute deutlich: Diese Rolle reicht nicht mehr aus. In einer Zeit, in der Lernen individuell, flexibel und kontinuierlich stattfinden muss, braucht es Personalentwicklerinnen, die als Gestalterinnen und Begleiterinnen* agieren – mit einem tiefen Verständnis für Kompetenzen, Werte und die konkreten Herausforderungen der Mitarbeitenden.
Von der Verwaltung zur individuellen Entwicklungsbegleitung
Statt pauschaler Fortbildungsempfehlungen geht es heute darum, gezielt Entwicklungsbedarfe zu identifizieren und passende Lernwege zu ermöglichen. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Lernprozesse strategisch zu denken, Rahmenbedingungen aktiv mitzugestalten und Mitarbeitende über längere Zeiträume hinweg zu begleiten. Personalentwicklung wird damit zu einer Schnittstelle zwischen Organisationsstrategie und individueller Kompetenzentwicklung – und zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für Wandel und Innovation.
Lernbegleiter als Coach, Mentor und Entwicklungspartner
In dieser neuen Lernkultur übernehmen Lernbegleiter eine zentrale Rolle. Sie sind nicht länger Wissensvermittler im klassischen Sinne, sondern agieren als Coach, Mentor und Entwicklungspartner. Ihre Aufgabe ist es, Lernprozesse zu strukturieren, Reflexion zu ermöglichen, motivierende Impulse zu geben und bei Bedarf gezielt zu unterstützen – ohne den Lernenden die Verantwortung abzunehmen. Lernbegleitung bedeutet auch, Raum für Fehler und persönliche Entwicklung zu schaffen und gleichzeitig Verbindlichkeit im Lernprozess sicherzustellen.
Ulrike Hagemann beschreibt diese Beziehung treffend als eine Art Doppeldeckerbus: Beide – Lernende und Lernbegleiter – entwickeln sich im Prozess gegenseitig weiter, reflektieren gemeinsam und arbeiten auf Augenhöhe.
Digitale Begleitung: Neue Tools für eine neue Lernkultur
Gerade in hybriden oder vollständig digitalen Lernumgebungen ist eine gezielte digitale Begleitung entscheidend. Ulrike Hagemann setzt in ihrer Arbeit auf eine Kombination aus:
- Virtuellen Lernplattformen, die nicht nur Inhalte bereitstellen, sondern auch Interaktion ermöglichen (z. B. über Kommentar- oder Austauschfunktionen)
- E-Coachings, bei denen Mitarbeitende individuell begleitet und bei Bedarf gecoacht werden
- Communities of Practice, die den sozialen Aspekt des Lernens stärken und kollegialen Austausch fördern
Diese digitalen Elemente unterstützen nicht nur die Selbstlernphase, sondern schaffen auch ein soziales Lernumfeld, das Motivation und Engagement fördert. Denn auch in der digitalen Welt gilt: Lernen ist ein sozialer Prozess – und gute Begleitung macht den Unterschied zwischen Konsum und echter Entwicklung.
Erfolgsfaktoren einer nachhaltigen Kompetenzentwicklung
Kompetenzentwicklung ist kein Zufallsprodukt – sie braucht klare Strukturen, individuelle Ausrichtung und ein unterstützendes Umfeld. Damit Lernen nicht zur Pflichtveranstaltung wird, sondern zur echten Weiterentwicklung führt, sind mehrere Erfolgsfaktoren entscheidend.
Klare Kompetenz- und Lernziele definieren
Nur wer weiß, wohin die Lernreise gehen soll, kann gezielt Fortschritte machen. Deshalb beginnt jeder Entwicklungsprozess mit der Festlegung konkreter Kompetenz- und Lernziele. Diese orientieren sich sowohl an den Anforderungen des Unternehmens als auch an den Potenzialen und Interessen der Mitarbeitenden.
Individuelle Entwicklungswege festlegen und kontinuierlich begleiten
Jede Person lernt anders – deshalb ist es zentral, individuelle Lernpfade zu gestalten. Selbstorganisierte Lernprojekte, persönliche Mentoring-Beziehungen oder die Einbindung in Communities of Practice sind wirksame Mittel, um nachhaltiges Lernen zu fördern. Wichtig dabei: Die kontinuierliche Begleitung durch Lernbegleiter oder Führungskräfte, um Motivation und Zielorientierung aufrechtzuerhalten.
Geeignete Lernformate auswählen und flexibel anpassen
Ob E-Learning, Präsenzseminar oder hybrides Format – entscheidend ist, dass das gewählte Format zum Lerninhalt, zur Zielgruppe und zum Arbeitskontext passt. Lernangebote sollten modular, alltagsnah und leicht zugänglich sein. Kleine Lern-Nuggets, praxisnahe Übungen oder digitale Sprechstunden erhöhen den Transfer und senken die Hemmschwelle.
Führungskräfte als aktive Unterstützer und Coaches gewinnen
Führungskräfte spielen eine zentrale Rolle in der Kompetenzentwicklung. Sie sind nicht nur Impulsgeber, sondern auch Lernbegleiter – etwa im jährlichen Entwicklungsgespräch, als Feedbackgeber im Alltag oder als Coach im Rahmen von Lernprojekten. Wenn Führungskräfte Lernen vorleben und aktiv unterstützen, wird es Teil der Unternehmenskultur.
Kontinuierliche Reflexion und Anpassung des Lernprozesses
Lernen ist kein statischer Prozess. Deshalb braucht es regelmäßig Raum zur Reflexion: Was hat gut funktioniert? Wo bestehen noch Lücken? Welche neuen Anforderungen sind entstanden? Lernprozesse müssen dynamisch weiterentwickelt und an aktuelle Entwicklungen angepasst werden – sei es technologischer, organisatorischer oder individueller Natur.
Ausblick: Kompetenzen für die Herausforderungen von morgen entwickeln
Die Zukunft ist ungewiss – aber eines ist sicher: Die Anforderungen an Mitarbeitende und Organisationen werden sich weiter rasant verändern. Themen wie Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit oder digitale Transformation fordern nicht nur technisches Wissen, sondern vor allem die Fähigkeit, mit Unsicherheit und Veränderung umzugehen.
Zukunft aktiv gestalten – statt nur reagieren
Unternehmen und Verwaltungen, die bereits heute in eine kompetenzorientierte Lernkultur investieren, schaffen sich einen klaren Vorsprung. Sie befähigen ihre Mitarbeitenden dazu, neue Technologien nicht nur zu nutzen, sondern auch kritisch zu hinterfragen und sinnvoll einzusetzen – etwa um Probleme zu lösen, die heute noch gar nicht existieren.
Unsicherheit kreativ begegnen
Kompetenzentwicklung heißt auch: Menschen stärken, damit sie in komplexen und oft chaotischen Situationen handlungsfähig bleiben. Wer gelernt hat, sich selbst zu organisieren, im Team zu lernen und eigenständig Lösungen zu entwickeln, wird nicht von der Dynamik der Zukunft überrollt – sondern gestaltet sie aktiv mit.
Kernthese: Kompetenzentwicklung macht zukunftsfähig
Die zentrale Erkenntnis lautet daher: Nicht das Fachwissen allein, sondern die Fähigkeit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung macht Mitarbeitende – und damit ganze Organisationen – zukunftsfähig. Lernen wird damit zur strategischen Aufgabe – und zur vielleicht wichtigsten Investition in eine erfolgreiche Zukunft.
Fazit: Werte- und kompetenzbasiertes Lernen als Erfolgsfaktor der Zukunft
Die Zeiten eindimensionaler Weiterbildungsformate sind vorbei. In einer Welt, die von Geschwindigkeit, Unsicherheit und technologischem Wandel geprägt ist, braucht es eine neue Lernkultur – eine, die nicht auf reinen Wissenstransfer setzt, sondern auf echte Kompetenzentwicklung. Werte, Selbstorganisation und lebenslanges Lernen werden dabei zu tragenden Säulen.
Der Beitrag von Ulrike Hagemann zeigt eindrucksvoll, wie Unternehmen und Verwaltungen diesen Wandel gestalten können – mit individuellen Lernpfaden, digitalen Begleitformaten, aktiver Führungskräftebeteiligung und einer neuen Rolle für die Personalentwicklung als Impulsgeberin und Entwicklungsbegleiterin.
Der Aufruf ist klar: Wer zukunftsfähige Mitarbeitende will, muss heute die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Es geht nicht nur darum, was Menschen lernen – sondern wie. Personalentwicklung ist mehr als eine administrative Aufgabe. Sie ist ein strategischer Hebel für Innovationskraft, Resilienz und nachhaltigen Erfolg.
Jetzt ist die Zeit, diesen Wandel aktiv anzugehen – mit Mut, Klarheit und dem Vertrauen darauf, dass Menschen lernen wollen. Man muss sie nur lassen.
Präsentation
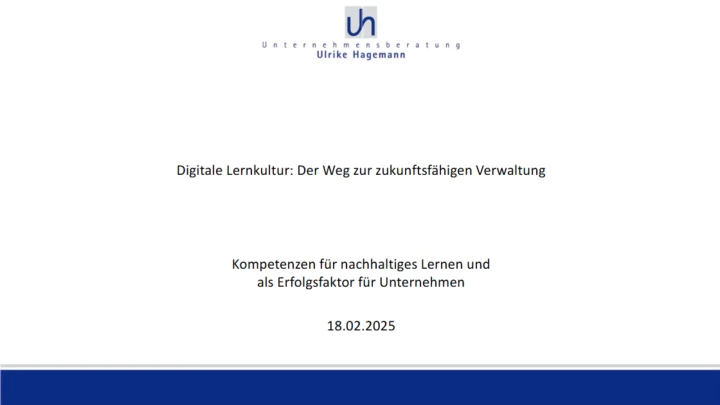
Kompetenzen für nachhaltiges Lernen und als Erfolgsfaktor für Unternehmen
Ulrike Hagemann, Ulrike Hagemann / Hochschule Bochum
Veranstaltung

Digitale Lernkultur: Der Weg zur zukunftsfähigen Verwaltung
Erfahren Sie, wie die digitale Lernkultur im öffentlichen Dienst die Basis für kontinuierliche Weiterbildung und Mitarbeiterzufriedenheit schafft.
Artikel

Digitale Lernkultur: Bildung neu denken für die Zukunft
Wie digitale Lernformate, Future Skills und Microdegrees Bildung transformieren – jetzt mehr erfahren!
